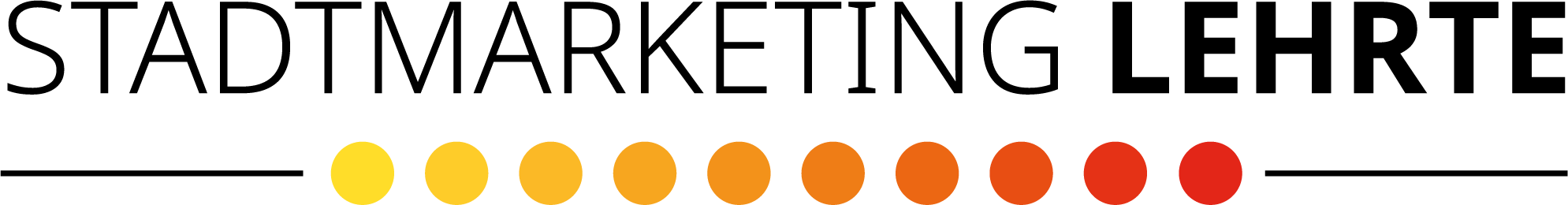Winterlinde
Baum des Jahres 2016, Heilpflanze des Jahres 2025
Steinlinde, Spätlinde, kleinblättrige Linde, Waldlinde, bee-tree (Amerika)
Die Winterlinde ist ein sommergrüner Baum, der bis zu 30 Meter hoch wird und ein Alter von 600 bis 800, selten bis 1000 Jahren erreicht. Eine alte Volksweisheit behauptet: „Die Linde kommt 300 Jahre, sie steht 300 Jahre und vergeht 300 Jahre“. Weltweit gibt es etwa 40 Lindenarten, von denen die meisten in den Tropen beheimatet sind. Durch Kreuzungen, natürliche Hybriden und Züchtungen sind verschiedene Arten entstanden, die oft nur schwer zu unterscheiden sind. Sie weisen aber viele Gemeinsamkeiten auf und lassen sich alle gleichermaßen nutzen.
Am häufigsten sind bei uns die Sommerlinde (Tilia platyphyllos) und die Winterlinde (Tilia cordata) anzutreffen, die vielerorts auch das Straßenbild prägen. Durch Kreuzung der beiden Arten ist die Holländische Linde (Tilia europaea) entstanden, die Merkmale beider Elternarten aufweist. Die Krimlinde (Tilia euchlora), eine Kreuzung aus Winterlinde und Kaukasischer Linde, wird häufig als Baum in Parkanlagen gepflanzt. Darüber hinaus kommt bei uns noch die Silberlinde (Tilia tomentosa) mit unterseits weiß-filzigen Blättern vor, die ursprünglich aus Südosteuropa und Kleinasien stammt.
Die Winterlinde gehört zur Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Sie ist mit der Baumwolle und dem Kakaobaum verwandt und in Europa und Vorderasien schon vor den Eiszeiten heimisch gewesen. Nur selten kommt die Linde als Baum des Waldes vor. Dort würde sie eine Durchmischung mit anderen Baumarten wie Buche, Eiche, Esche und Ahorn bevorzugen. Häufiger wird sie in Parkanlagen und als Straßenbaum angepflanzt. Sie benötigt einen tiefgründigen, lockeren Boden mit guter Wasserversorgung und bildet ein tiefgreifendes Herzwurzelsystem.
Die Linde mag es nicht, wenn ihr Stamm der Sonne ausgesetzt ist. Werden die unteren Zweige abgeschnitten, umgibt sie den Stamm stets mit neuen Austrieben. Bei freistehenden Linden reichen die Äste oft bis zum Boden. Forstwirtschaftlich hat die Linde keine Bedeutung. Das innere Holz des Stammes ist fäulnisanfällig und zerfällt leicht. Indem im alten Stamm neue Innenwurzeln und eine neue Krone wachsen, kann sich der Baum aber von innen heraus stabilisieren.
Die breite, rundliche Krone hat Form eines Lindenblattes. Die Rinde ist zunächst hellgrau und glatt, später tiefbraun und längsgefurcht. Direkt unter der Rinde befinden sich viele lange Bastfasern, die früher ein wichtiger Bindestoff waren und bereits in der Jungsteinzeit zum Binden, Flechten und Weben gebraucht wurden. Seile, Matten und Bienenkörbe, auch Säcke und Kleidung wurden daraus hergestellt. Die Römer nutzten den Bast auch für die Sehnen ihrer Bögen. Heute wird Lindenbast fast nur noch zum Basteln gebraucht.
Das Holz der Linde ist von sehr gleichmäßiger Struktur, leicht, weich und elastisch. Es lässt sich gut spalten und bearbeiten und ist beim Trocknen rissfest. Es wird überall dort eingesetzt, wo ein leichtes und sauber zu bearbeitendes Holz verlangt wird. Als „lignum sacrum“ (lat. = heiliges Holz) war es das Grundmaterial für Schnitzarbeiten, das von berühmten Sakralkünstlern, z.B. Tilman Riemenschneider und Veit Stoß wegen seines schönen Glanzes geschätzt und bearbeitet wurde. Viele aus dem Holz gefertigte Heiligenfiguren, Altäre und Kreuze sind noch heute zu bewundern. Auch Krippenfiguren, Marionetten und Köpfe für Handpuppen werden aus Lindenholz geschnitzt, ebenso die kunstvollen Masken der alemannischen Fastnacht und die Frontpartien von Kuckucksuhren. Im Instrumentenbau wird das Lindenholz als Material für die Tastaturen von Klavieren und die Zungen von Orgelpfeifen genutzt, auch für die Herstellung von Papier, Zellstoff und Faser- und Spanplatten. Leider lieben auch Holzwürmer das Lindenholz, so dass für Gegenstände, die aus dem Holz gefertigt werden, ein Holzschutz unbedingt erforderlich ist.
Anfang Mai – meist zwei Wochen nach der Sommerlinde - erscheinen die jungen olivgrünen glänzenden Triebe, die anfangs fein behaart sind. Die wechselständigen Blätter sind etwas asymmetrisch herzförmig mit fein gezähntem Rand und hängen an etwa 5 cm langen Stielen. Sie sind beiderseits kahl und unterseits blaugrün. An der Unterseite der Laubblätter, in den Achseln der Blattnerven, sitzen rostbraune Haarbüschel.
Erst im Alter von 20 Jahren erscheinen nach dem Blattaustrieb je Baum bis zu 60 000 helle, gelbliche, zwittrige Blüten mit fünf Kelchblättern, fünf Kronblättern und bis zu 30 Staubblättern. Sie stehen in einem rispenähnlichen Blütenstand mit fünf bis sieben Blüten und sind mit einem zungenförmigen blassgrünen Hochblatt teilweise verwachsen. Die Blüten duften angenehm und produzieren bis zu 5 mg Zucker pro Tag und Blüte. Deshalb sind sie eine ergiebige Nektar- und Pollenquelle für Hummeln und Bienen, die den köstlichen Lindenblütenhonig erzeugen. Damit die Selbstbestäubung der Blüte möglichst vermieden wird, reifen die männlichen Staubblätter schneller als die weibliche Narbe. Der Nektar befindet sich am Grund der Kelchblätter. Sobald die Blüte bestäubt ist, hört die Nektarproduktion auf. Für die Imker waren Linden schon immer wichtige Trachtpflanzen, die „gebannt“ waren und deshalb nicht gefällt werden durften, vielleicht ein Grund, weshalb viele Linden ein hohes Alter erreichen konnten.
Steckbrief
- Pflanzenfamilie: Malvengewächse Malvaceae
- Anwendungsbereich: schweißtreibend, Steigerung der Abwehrkräfte, Durchfall
- Blütenfarbe: gelb
- Giftigkeit: ungiftig
- Lebensdauer: ausdauernd
Blütezeit
Juni, Juli
Typisch für die Linde ist der Befall mit Blattläusen. Diese saugen den Saft aus den Leitungsbahnen der Blätter und scheiden den überschüssigen Zucker als Honigtau aus. Wenn die Bienen diesen Honigtau sammeln und eintragen, produzieren sie Lindenhonig. Der zuckerhaltige Saft auf den Blättern ist jedoch ein idealer Nährboden für Rußtaupilze, die die Fotosynthese des Baums beeinträchtigen können, und für Autohalter, die ihre Fahrzeuge, die unter Linden geparkt haben, bedeutet der klebrige Belag ein großes Ärgernis. Aus den Blüten entwickeln sich bräunliche, oval-kugelige, erbsengroße weiche Nüsschen, die als Drehflügler mit Hilfe des zungenförmigen Hochblatts fliegen und durch den Wind bis zu 60 Meter weit fortgetragen werden.
Verwendete Pflanzenteile
Die Knospen können frisch geknabbert werden. Die voll entwickelten Blütenstände mit dem Hochblatt, die kurz nach dem Aufblühen geerntet werden (erst seit dem 17. Jahrhundert) werden für Tee, Umschläge und als Badezusatz genutzt. Die Lindenholzkohle (Carbo tiliae), die Giftstoffe bindet und bei Durchfall, Sodbrennen und Magen-Darm-Infektionen helfen kann. Sie wird als Zeichenkohle und Filterkohle verwendet, früher auch zur Zahnpflege. Die jungen Blätter können als Salat, Gemüse oder Pesto verzehrt werden und eignen sich auch für Füllungen. Die Rinde kann als Tee bei Leber-, Galle- und Bauchspeicheldrüsenleiden helfen. Der Lindenbast diente als Verbandmaterial Die getrockneten Früchte können mit den getrockneten Blüten in Kräuterkissen genutzt werden.
Inhaltsstoffe
Schleim, Gerbstoffe, ätherische Öle, (Farnesol bewirkt den angenehmen Duft), Flavonoide, Vitamine C und E
Heilwirkung
Seit Jahrhunderten wird die Linde als „Apotheke“ angesehen. Die Inhaltsstoffe der Lindenblüten wirken schweißtreibend und auf Grund des Gehalts an Gerb- und Schleimstoffen auswurffördernd und reizlindernd. Lindenblütentee kann die Abwehrkräfte steigern und wird bei Erkältungskrankheiten mit dem damit verbundenen Husten eingesetzt. Die Kommission E empfiehlt die Blüten bei Erkältungskrankheiten und trockenem Reizhusten. Äußerlich können Teekompressen zur Hautpflege genutzt werden, auch bei Entzündungen, Abszessen und Furunkeln. Die Lindenkohle wird bei Magen- und Darminfektionen mit Durchfall verwendet. Sie kann Bakteriengifte binden und unschädlich machen.
Nebenwirkungen
Nicht bekannt
Geschichtliches
Der Gattungsname „Tilia“ ist vom griechischen Wort „tilos“ = Bast, Faser abgeleitet. Der deutsche Name „Linde“ soll vom indogermanischen „lentos“ = geschmeidig, elastisch hergeleitet sein. „Cordata“ im Artnamen ist lateinischer Herkunft und bedeutet „herzförmig“.
Seit alters her spielt die Linde in der Geschichte eine große Rolle. In der Antike wurden die Lindenblüten nicht verwendet. Hildegard von Bingen schrieb der Linde eine große erwärmende Kraft zu, die von den Wurzeln ausgehen soll. Die Lindenblätter dienten als Nahrung für Tiere, als Stalleinstreu und auch als Tabakersatz.
Bei den Germanen war der Baum Freya, der Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Glücks geweiht. Oft in die Nähe des Hauses gepflanzt, sollte die Linde Schutz vor Blitzschlag, bösen Geistern und Hexen bieten. Mit der Christianisierung wurden die Freya-Linden zu Marien-Linden erklärt. Wegen der herzförmigen Blätter wurde die Linde als Baum der Liebe und Leidenschaft angesehen. Zur Geburt eines Stammhalters pflanzten die glücklichen Eltern oft eine Linde.
Als Baum des Volkes stand die Linde oft im Mittelpunkt des Dorfes. Sie war der öffentliche Versammlungsort, wo alle Angelegenheiten der Gemeinschaft besprochen wurden. Zugleich war sie Treffpunkt für den Informationsaustausch und für gesellige Veranstaltungen. Manche Linden wurden als Tanzlinden genutzt, indem in die Krone des Baumes ein Boden eingebaut wurde, auf dem die Musikanten ihren Platz bekamen und der über Treppen und Leitern erreicht werden konnte. Unter der Linde wurde dann getanzt. Dazu heißt es im Osterspaziergang von Goethes Faust: „Schon um die Linde war es voll, und alles tanzte schon wie toll.“ Deshalb galt die Linde als der Symbolbaum für Heimat und Eintracht, aber auch für Gerechtigkeit. Unter der Linde wurde zudem Gericht gehalten, weil man dem Baum die Kraft zur Wahrheitsfindung zusprach. Ein Spruch, der bis heute existiert, heißt: „Unter der Linde kommt die Wahrheit zutage“, „Judicum sub tilia“ = das Gericht unter der Linde. (Der Begriff „subtil“ = „mit Feingefühl“ ist davon abgeleitet.) Das, was unter der Linde beschlossen wurde, hatte Gültigkeit. An der Göttinger Gerichtslinde erfolgte 1859 eine letzte Hinrichtung.
Viele Orts- und Straßenbezeichnungen erinnern an die Linde: z.B. Lindau, Linz, Hannover-Linden, „Unter den Linden“ in Berlin, ebenso die Fernsehsendung „Lindenstraße“. Der Name „Zur Linde“ ist in Deutschland der häufigste Gasthausname. Deutschlandweit wurden „Friedenslinden“ zum Gedenken an den Westfälischen Frieden von 1648 gepflanzt, ebenso zur Erinnerung an den gewonnenen deutsch-französischen Krieg 1870/71. Eine Kaiserlinde (Tilia pallida), die am 05.10.1990 in der Nähe des Reichstags in Berlin gepflanzt wurde, erinnert an den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Auch in Liedern wird der Baum besungen. Das bekannteste dürfte „Am Brunnen vor dem Tore“ von Franz Schubert sein.
In Hannover führt eine fast zwei Kilometer lange Allee, die aus vier Reihen Linden besteht, vom Königsworther Platz direkt nach Herrenhausen. 1726 wurde sie als Verbindung zwischen dem Leineschloss und der Sommerresidenz angelegt. Weil die Bäume im Zweiten Weltkrieg schwer geschädigt waren, wurden von 1972 bis 1974 alle Alleebäume gefällt und durch 1300 Kaiserlinden (Tilia europaea ‚pallida‘), einer Varietät der Holländischen Linde, ersetzt, die besonders geeignet für Anpflanzungen in Alleen und Parkanlagen ist.
In vielen weiblichen Vornamen findet sich der Name des Baumes: Linda, Rosalinde, Sieglinde, Gerlinde, Dietlind… Auch der Name des Naturforschers Carl von Linné, der die moderne biologische Systematik eingeführt hat, geht auf die Linde zurück.
In den germanischen Heldensagen wird von Siegfried erzählt, der den Drachen Fafnir unter einer Linde getötet und in dem Drachenblut gebadet hatte. Dadurch wurde er scheinbar unverwundbar. Beim Baden hatte sich jedoch ein Lindenblatt genau zwischen seine Schulterblätter gelegt, so dass er an dieser Stelle verwundbar war. Genau dort wurde er hinterrücks von Hagen getroffen und getötet.
Auch in der griechischen Sagenwelt wird die Linde erwähnt. Für die Griechen war es eine Gnade der Götter, wenn Menschen in einen Baum verwandelt wurden. In der Sage von Philemon und Baucis, zwei alten Leuten, stand eine Linde auf einem Hügel dicht bei einer mächtigen Eiche. Göttervater Zeus und sein Sohn Hermes wollten in Menschengestalt die Gastlichkeit der Menschen prüfen. Sie wurden jedoch an vielen Türen abgewiesen und fanden erst in der ärmlichen Hütte von Philemon und Baucis Unterschlupf. Das greise, glückliche Paar nahm die Gäste auf und bewirtete sie. Zum Dank für ihre Gastfreundschaft wünschten sie sich, nicht durch den Tod getrennt zu werden, sondern in derselben Stunde sterben zu dürfen, weil keiner ohne den anderen sein wollte. Ihr Wunsch wurde erfüllt: Die Götter verwandelten Philemon in die Eiche, Baucis in die Linde.
Die Linde „verbindet Tradition und Moderne und tut das Seinige zur Beruhigung der teilweise hyperbeschleunigten Gesellschaft“, so ein Jurymitglied zur Wahl der Winterlinde als Heilpflanze 2025.

05132 505 1150 | Rathausplatz 1 | 31275 Lehrte
Stadtmarketing Lehrte e.V.