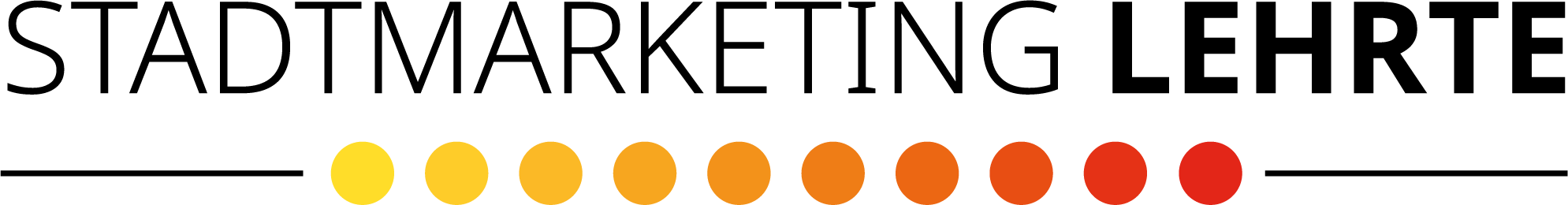sellerie
Eppich, Suppenkraut, Zellerich, Wasserpetersilie Geilwurz, Stehwurzel
Der Knollensellerie, der aus dem wild wachsenden Sumpfsellerie hervorgegangen ist, stammt aus dem Mittelmeerraum und gehört Familie der Doldengewächse (Apiaceae). Im Handel werden unterschiedliche Zuchtformen des Selleries angeboten: Knollensellerie, Schnittsellerie und...
Steckbrief
- Pflanzenfamilie: Doldengewächse (Apiaceae)
- Anwendungsbereich: Verdauungsförderung, harntreibend
- Blütenfarbe: gelb-weißgrün
- Giftigkeit: ungiftig
- Lebensdauer: zweijährig
Blütezeit
Blütezeit: April bis Oktober.
Aus den Blüten entwickeln sich rundliche, bis 2 mm lange Früchte. Alle Pflanzenteile haben einen charakteristischen Geruch, der an den von Petersilie und Liebstöckel erinnert.
Verwendete Pflanzenteile
Knolle, Kraut, Früchte und das daraus gewonnene ätherische Öl, das in allen Pflanzenteilen enthalten ist.
Inhaltsstoffe
Knolle: Ballaststoffe, Kohlenhydrate, ätherisches Öl, Flavonoide, Vitamine A, C, E, K, B-Vitamine, Mineralien Kalium, Natrium, Calcium, Eisen, Zink Blätter: Ätherisches Öl, Flavonoide, Cumarine, Vitamine; der Vitamingehalt der grünen Blätter ist deutlich höher als der der Knolle. Früchte: Ätherisches Öl, Flavonoide, fettes Öl
Heilwirkung
Sellerie regt den Speichelfluss und die Gallesekretion an und wirkt deshalb verdauungsfördernd. Der frische Saft aus der Knolle und dem Kraut, ebenso wie die Früchte und das daraus gewonnene ätherische Öl wirken harntreibend. Diese Wirkung wird auch erzielt, wenn man mit Sellerie würzt oder die Knolle als Gemüse verwendet. In der Schulmedizin wird der Sellerie wenig eingesetzt, die Volksmedizin nutzt die Wirkstoffe bei rheumatischen Beschwerden, bei Blasenentzündungen, Bluthochdruck, Diabetes, Arthritis und Ödemen. In der Homöopathie kommt Apium graveolens bei Harnverhalten, Rheuma und Sodbrennen zum Einsatz. Früher wurde Sellerie auch als potenzsteigernd angesehen.
Nebenwirkung
Sellerie ist die Pflanze, die am häufigsten allergische Reaktionen hervorruft. Deshalb muss nach EU-Recht angegeben werden, wenn Sellerie in Fertigprodukten von Lebensmitteln enthalten sein kann. Nierenkranke sollten Sellerie nicht in großen Mengen verzehren.
Geschichtliches
Bei den Griechen wurde der Sellerie nicht deutlich von der Petersilie unterschieden, beide wurden „sélinon“ benannt. Die Römer nannten die Pflanze „sedano“ oder „apium“. Aus diesen Bezeichnungen bildeten sich die deutschen Namen Sellerie und Eppich. „Graveolens“ im Artnamen wird gebildet aus „gravis“ = stark, schwer, „olere“ = riechen weist auf den starken Geruch der Pflanze hin.
Im alten Ägypten wurden die Blätter und Blüten des wildwachsenden Sellerie den Verstorbenen mitgegeben. Bei den Griechen und Römern war Sellerie dem Gott der Unterwelt geweiht. Grabhügel wurden oft mit Sellerie bepflanzt, Grabmäler mit Sellerieblättern geschmückt. Auch die Sieger bei sportlichen Wettkämpfen bekamen einen Kranz aus Sellerieblättern. Hippokrates empfahl die Pflanze als heilsame Nahrung, Dioskurides verordnete sie bei Augenentzündungen und als Diuretikum. Auch eine aphrodisierende Wirkung wurde dem Sellerie zugeschrieben.
Im frühen Mittelalter gelangte die Pflanze nach Mitteleuropa und wird im „Capitulare de villis“ Karls des Großen und im St. Gallener Klosterplan erwähnt und zum Anbau empfohlen. Hildegard von Bingen nutzte Sellerie als Mittel, um die Periode auszulösen, aber auch zur Abtreibung. Periodenmittel sollen bei Männern eher potenzsteigernd wirken.
Wolf-Dieter Storl weist in seinem Buch „Bekannte und vergessene Gemüse“ mit einem französischen Sprichwort auf diese dem Sellerie zugeschriebene Eigenschaft hin: „Wüsste die Frau, was der Sellerie dem Mann antut, sie würde von Paris bis Rom gehen, um das Kraut zu holen.“ Und: „Wüsste der Mann um die Wirkung des Selleries, er würde sein Gärtlein damit vollpflanzen.“
Vornehmlich wurde Sellerie als Mittel gegen Blähungen und bei Blasen-, Nieren- und Leberleiden genutzt. Paracelsus empfahl die Samen bei Steinleiden und Ödemen. In den Kräuterbüchern des 16. Und 17. Jahrhunderts wurden die Wurzel, das Kraut und die Früchte als Arzneimittel gegen Harnverhalten und Gelbsucht empfohlen. Der frisch ausgepresste Saft diente zur Behandlung von Geschwüren. Der Anbau von Sellerie blieb aber auf Klostergärten beschränkt. Erst seit dem 17. Jahrhundert wurden die Kulturformen des Selleries gezüchtet.
Wegen des allergischen Risikos, das vom Sellerie ausgeht, und weil die Anwendungsgebiete für die Pflanze wissenschaftlich nicht belegt sind, erhielt Sellerie von der Kommission E eine Nullmonografie.

05132 505 1150 | Rathausplatz 1 | 31275 Lehrte
Stadtmarketing Lehrte e.V.