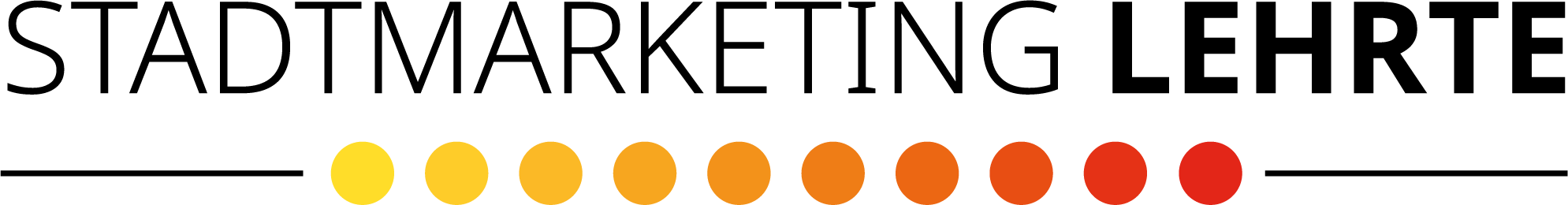Hauswurz
Dachwurz, Donnerwurz, Donnerkraut, Dach-Hauswurz, Dachlauch, Erdrose, Steinrose
Die Hauswurz ist eine ausdauernde Pflanze aus der Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae), die Wuchshöhen von 10 bis 15 cm erreicht. Mit zahlreichen Arten und mehreren tausend Sorten ist sie in Mittel- und Südeuropa heimisch, wächst vor allem im Gebirge, auch in Felsspalten und kommt auch auf alten Gemäuern vor. Sie benötigt sonnige Standorte auf trockenem, durchlässigem Boden und kiesiger, sandiger Erde und eignet sich zur Dachbegrünung. Hauswurz verträgt keinen Dünger und muss bestenfalls bei langer Trockenheit gegossen werden. Im Winter benötigt die Pflanze Kälte und keinen besonderen Schutz, weswegen sie für Zimmerkultur ungeeignet ist.
Hauswurz bildet eine Blattrosette mit fleischigen, dachziegelartig angeordneten Blättern. Aus der Blattrosette heraus wachsen Blütenstände, die bis zu 50 cm lang werden können. Die blühenden Stängel sind dicht beblättert, die rosafarbenen Blüten mit purpurroten Streifen stehen in einem doldenartigen Blütenstand.
Die erste und einzige Blüte einer Pflanze erscheint im Alter von 2 – 3 Jahren, danach stirbt die Pflanze ab. Zuvor aber werden im unmittelbaren Umfeld der Pflanze Tochterrosetten gebildet, die auch an Ausläufern wachsen können.
Steckbrief
- Pflanzenfamilie: Dickblattgewächse Crassulaceae
- Anwendungsbereich: Gürtelrose, Insektenstiche, Verbrennungen
- Blütenfarbe: rosa
- Giftigkeit: schwach giftig
- Lebensdauer: ausdauernd
Blütezeit
Mai bis August
Die Pflanze steht unter Naturschutz.
Die fein geschnittenen, säuerlich schmeckenden Blätter eignen sich als Salatbeigabe.
Verwendete Pflanzenteile
Blätter
Inhaltsstoffe
Apfelsäure, Tannin, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Schleim, Vitamin C, Kalium, Harz, Ameisensäure
Heilwirkung
Hauswurz wirkt kühlend, beruhigend, wundheilend. Volksheilkundlich wird die Pflanze äußerlich bei Gürtelrose, Insektenstichen, Verbrennungen, Geschwüren und Hühneraugen verwendet und aus den frischen, kleingeschnittenen Blättern eine Wundauflage auf die betroffenen Hautstellen aufgelegt.
Insgesamt ist die Hauswurz pharmakologisch noch nicht genügend erforscht.
Nebenwirkungen
Bei innerer Anwendung können Übelkeit und Erbrechen auftreten.
Geschichtliches
Der Gattungsname ist lateinischen Ursprungs: „semper“ = immer, „vivum“ (von vivere) = leben. Der Artname „tectorum“ nimmt Bezug auf die römische Sitte, die Pflanze auf Dächern zu kultivieren und bedeutet „auf dem Dach wachsend“.
Bereits in der Antike wurde die Pflanze genutzt. Dioskurides lobte die kühlende Wirkung von Hauswurz bei Verbrennungen.
Karl der Große ordnete an, jedes Dach mit Hauswurz zu bepflanzen, damit es gegen Blitzschlag geschützt sein sollte. (Solche Dächer sind nicht so trocken und daher auch nicht so leicht entflammbar.)
Die Hauswurz gilt als Zauberpflanze und wurde als Bestandteil von Hexensalbe verwendet. Ihr wurden magische Kräfte nachgesagt, die besonders wirksam sein sollten, wenn die Pflanze an einem Donnerstag gesammelt wurde.
Um Hexen abzuwehren, hängte man bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz Hauswurzpflanzen in den Schornstein.
Sprichwörter:
Wer edle Hauswurz hält in Ehren, der kann wohl manchem Übel wehren.
Und bei den Roma heißt es: Eine Hauswurz auf dem Haus ist besser als zwei Hunde vor dem Haus.

05132 505 1150 | Rathausplatz 1 | 31275 Lehrte
Stadtmarketing Lehrte e.V.