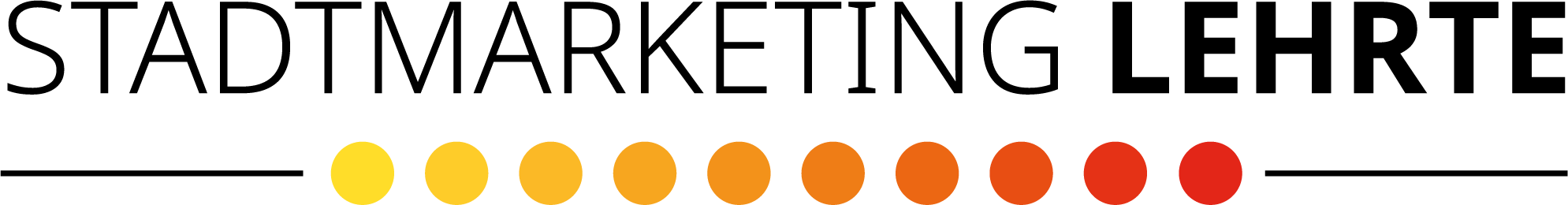Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Akzeptieren Sie unsere Cookies?
Essentielle Cookies:
- Youtube
- Google Maps
Optionale Cookies:
- Google Analytics
Buchweizen
Arzneipflanze des Jahres 1999
Heidenkorn, Heiden, Tartarenkorn, Sarazenenkorn, Türkischer Weizen, Bokweten
Der Buchweizen ist kein Getreide, wie der Name vermuten lässt, sondern gehört wie Sauerampfer und Rhabarber zur Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae). Er wird dem „Nichtbrotgetreide“ (Pseudo-Cerealie) zugerechnet. Ursprünglich stammt er aus Mittel- und Ostasien und kam im Mittelalter nach Europa. Heute wird er in der Bretagne, in Osteuropa und auch in Deutschland angebaut. Buchweizen wächst als einjährige krautige Pflanze und erreicht Höhen von 15 bis 60 cm. Er ist sehr anspruchslos und wird auf sandigen, sauren und kargen Böden angebaut, auf denen er relativ hohe Erträge erbringt. Auf frisch kunstgedüngten Flächen entwickelt die Pflanze zwar Blätter, aber keine Blüten. Buchweizen ist unempfindlich gegen Krankheiten und Schädlinge und benötigt deshalb keine Spritzmittel. Er wirkt als „Entgifter“ für den Boden und wird zur Gründüngung auf Blühstreifen ausgesät. Wegen seiner kurzen Vegetationszeit kann Buchweizen auch als zweite Kultur nach der Getreideernte angebaut werden. Seit einiger Zeit wird zudem getestet, ob Buchweizen als Energiepflanze für Biogasanlagen geeignet ist. Buchweizen ist kälteempfindlich und übersteht Temperaturen unter 3° C nicht. Der zunächst grüne, später rotgefärbte aufrechte, kahle, runde und hohle Stängel ist mit Knoten versehen. An diesem sitzen kurzgestielte, herz- oder pfeilförmige Blätter. In den Blattachseln entspringen die knäuelartigen Blütenstände mit zahlreichen kleinen, weißen oder rosafarbenen nektarreichen Blüten. Sie duften stark, werden gern von Insekten aufgesucht, blühen aber nur einen Tag lang. Blütezeit: Juni bis September Die Früchte, dreikantige dunkelbraune, silbergraue oder schwarze Nüsschen, sehen ähnlich aus wie kleine Bucheckern. Sie reifen innerhalb von 10 bis 12 Wochen heran. Sie sind von einer harten, roten Schale umgeben, die Giftstoffe enthält und entfernt werden muss. Dafür gibt es in der Landwirtschaft spezielle Schälmaschinen. Der für die Ernährung bestimmte Buchweizen kommt geschält in den Handel.
Steckbrief
- Pflanzenfamilie: Knöterichgewächse Polygonaceae
- Anwendungsbereich: Venenerkrankungen, Nahrungsmittel
- Giftigkeit: ungiftig
- Lebensdauer: einjährig
Verwendete Pflanzenteile
Früchte, Kraut
Inhaltsstoffe
Früchte: Hochwertiges Eiweiß (Lysin, Arginin und Tryptophan), das in seiner Wertigkeit alle Getreidearten übertrifft, Mineralien (Kalzium, Eisen, Kalium, Zink, Magnesium), B-Vitamine, Vitamin E,
Kraut: Rutin und andere Flavonoide, Gerbstoffe, Fagopyrin
Heilwirkung
Früchte: Die Körner werden zu Graupen, Grütze, Gries oder Mehl verarbeitet. Buchweizen wird wegen seines herben, nussigen Geschmacks zu kräftigen Gerichten verarbeitet und als Aufbaunahrung für Kranke empfohlen. Er wirkt leicht stopfend und kann bei Durchfallerkrankungen helfen. Buchweizen wird auch zur Vorbeugung gegen Arthrose empfohlen. Da die Früchte kein Gluten enthalten, eignen sie sich als Nahrung für Zöliakie-Betroffene. Die Körner werden zu Graupen, Grütze, Gries oder Mehl verarbeitet. Das Eiweiß aktiviert den Gehirnstoffwechsel, Lysin und Lezithin wirken als Nervennahrung und sollen die Lernfähigkeit verbessern, Tryptophan sorgt für guten Schlaf.
Kraut: Buchweizentee wird aus dem Kraut und aus den Früchten zubereitet. Auf Grund des hohen Gehalts an Rutin und anderen Flavonoiden wird das Buchweizenkraut zur Behandlung von Venenerkrankungen eingesetzt. Rutin senkt die Durchlässigkeit der Kapillarwände, fördert die Elastizität der Blutgefäße und verbessert die Zirkulation im Gewebe. Zudem kann das Kraut auch das Schweregefühl in den Beinen mindern. Die antioxidativen Flavonoide schützen vor schädlichen Sauerstoffradikalen und beugen der Arteriosklerose vor.
Nebenwirkungen
Früchte: In den Randschichten der Körner ist Fagopyrin, ein roter Farbstoff enthalten, der lichtempfindlich macht. Vor der Verwendung sollten die Samen mit heißem Wasser abgespült werden, damit sich der rote Schleim, der als Hauptverursacher der Lichtempfindlichkeit gilt, von den Randschichten löst.
Kraut: Auch bei längerer Anwendung sind kaum Nebenwirkungen zu befürchten. Bei intensiver Sonneneinstrahlung kann das Berühren des Krauts bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.
Geschichtliches
Buchweizen wurde schon vor 6000 Jahren im fernen Osten (China, Nepal, Sibirien) angebaut. Der Gattungsname ist lateinischer Herkunft „Fagus = (Buche) und „Pyros“ =(Weizen) und beschreibt das Aussehen der Früchte. Der Artname „esculentus“ = „essbar“. weist auf die Verwendung der Früchte hin, die dem einfachen Volk in Form von Grütze als Nahrungsmittel dienten.
In der Antike, in den mittelalterlichen Kräuterbüchern und auch im „Capitulare de villis“ Karls des Großen wird der Buchweizen noch nicht erwähnt. Im 17. Und 18. Jahrhundert wurde Buchweizen überall dort angebaut, wo Getreide nur schlecht gedieh. Später wurden auf den kargen Böden häufig Kartoffeln gepflanzt. Mithilfe von Kunstdünger wurde es aber auch möglich, ertragreichere Feldfrüchte als Buchweizen anzubauen. Grütze aus Buchweizenschrot war früher in vielen Gegenden ein Grundnahrungsmittel, besonders für die ärmere Bevölkerung.
Im 16. Jahrhundert hatte man festgestellt, dass Haustiere, die mit dem Buchweizenkraut gefüttert worden waren, Hautreaktionen zeigten. Diese „Buchweizenkrankheit“ führte bei hellhäutigen Tieren durch Sonnenlicht zu Hautrötungen und Entzündungen. Hervorgerufen wurde sie durch den nicht wasserlöslichen Stoff Fagopyrin, der eine ähnliche Wirkung wie das Hypericin im Johanniskraut hat, denn beide steigern die Lichtempfindlichkeit der Haut.
Erst in den 70er Jahren wurde Buchweizen als Heilpflanze entdeckt. Rutin wurde als Wirkstoff untersucht, und in klinischen Studien konnte die Wirksamkeit von Buchweizenkraut bei Gefäßerkrankungen nachgewiesen werden.

05132 505 1150 | Rathausplatz 1 | 31275 Lehrte
Stadtmarketing Lehrte e.V.