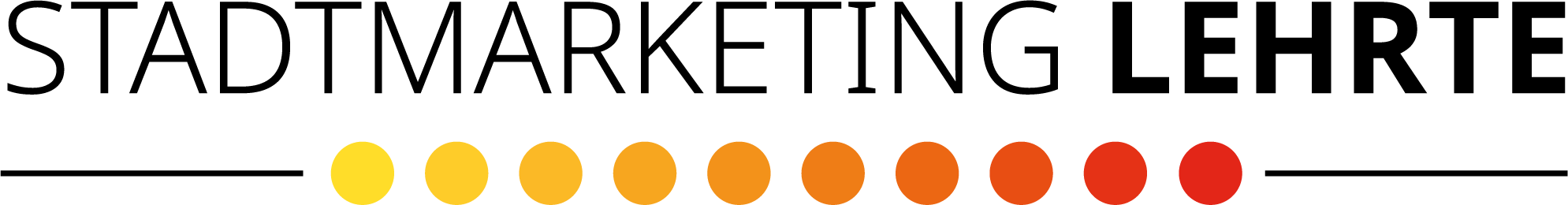Bärentraube
Mehlbeere, Sandbeere, wilder Buchs, Steinbeere, Wolfsbeere, Moosbeere, Harnkraut
Die Bärentraube ist ein immergrüner Halbstrauch mit weitkriechenden Ästen aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Die Pflanze ist in den subarktischen Gebieten heimisch und kommt vom Ural bis ins nördliche Sibirien und in Nordamerika vor, im südlichen Europa nur im Gebirge. Sie wächst auf sauren Böden in lichten, trockenen Kiefernwäldern, in Mooren und auf Heideflächen und wurzelt dort bis zu 1 m in die Tiefe. Im Aussehen ähnelt sie der Preiselbeere. Die Äste wachsen horizontal und bewurzeln sich gelegentlich. Sie sind dicht mit glänzenden, dick ledrigen, ganzrandigen, eiförmigen, grünen Blättern besetzt, die wechselständig an den Zweigen stehen und auf der Unterseite drüsig punktiert sind. Anfangs sind sie behaart, später kahl. Die weißen, glockenförmigen Blüten stehen zu mehreren – meist 3 bis 10 - in endständigen, etwas überhängenden Trauben zusammen. Die Kronblätter sind fast auf der gesamten Länge miteinander verwachsen. Blütezeit: März bis Juni Die Blüten werden durch Hummeln bestäubt, auch Selbstbestäubung ist möglich. Die kugeligen, mehligen Steinfrüchte werden 6 bis 8 mm groß und enthalten 5 bis 7 Samen. Die Früchte können zu Marmelade verarbeitet werden. Die Bärentraube ist in Deutschland geschützt.
Steckbrief
- Pflanzenfamilie: Heidekrautgewächse Ericaceae
- Anwendungsbereich: Harnwegserkrankungen, Rheuma
- Blütenfarbe: weiß
- Giftigkeit: schwach giftig
- Lebensdauer: ausdauernd
Verwendete Pflanzenteile
Die Blätter, die zu jeder Jahreszeit gepflückt werden können. Bevorzugte Erntezeit ist im Spätsommer und Herbst, weil die Blätter dann einen besonders hohen Gehalt an Arbutin aufweisen.
Inhaltsstoffe
Glykoside Arbutin und Methylarbutin, Gerbstoffe, Flavonoide, Harze
Heilwirkung
Bärentraubenblätter wirken adstringierend und fördern die Harnausscheidung. Der in ihnen enthaltene Pflanzenstoff Arbutin wirkt leicht desinfizierend und hemmt das Wachstum von Bakterien. Im Körper wird er in Hydrochinon umgewandelt, das über die Nieren wieder ausgeschieden wird. Bärentraubenblätter werden allein oder in Mischungen mit anderen Drogen bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege (Brennen beim Wasserlassen, Harndrang, Unterleibsschmerzen) als Blasen- und Nierentee verwendet. Bärentraube soll besser wirken, wenn der Harn alkalisch ist, wenn also mehr Obst oder Gemüse verzehrt wird und weniger tierisches Eiweiß auf dem Speiseplan steht. Über einen längeren Zeitraum (nicht länger als eine Woche und nicht öfter als fünfmal im Jahr) sollte Bärentraube nicht eingenommen werden.
Nebenwirkungen
Arbutin schädigt in hohen Dosen die Leber. Der hohe Gerbstoffgehalt der Blätter kann bei Personen mit empfindlichem Magen Übelkeit und Erbrechen hervorrufen. Deshalb wird eine Zubereitung als Kaltauszug empfohlen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit und für Kinder unter 12 Jahren darf keine Anwendung mit Bärentraube erfolgen.
Geschichtliches
Der wissenschaftliche Name stellt ein Tautonom (Verdoppelung derselben Bedeutung) dar: „arctos“ = Bär, „staphyle“ (griech.) = Traube und „uva“ = Traube und „ursus“ (lat.) = Bär. Der deutsche Name ist die Übersetzung des Gattungsnamens und des Artnamens aus dem griechischen und lateinischen. Angeblich sollen die Früchte gern von Bären gefressen werden.
Für die Indianer vom Stamme der Navahos war die Bärentraube ein Allheilmittel, das bei Blasen- und Nierenleiden eingesetzt wurde. Irokesenstämme nutzten den Tee gegen Frauenleiden und bei Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Die Heiler der Cheyennes legten Breiumschläge aus nassen und zerdrückten Blättern auf Gelenke, die durch chiropraktische Maßnahmen behandelt worden waren. Die Patienten bekamen zusätzlich einen Tee aus den Blättern zu trinken. Auch Cowboys sollen diese Therapie genutzt haben.
Die Bärentraube wurde bei den Völkern Nordeuropas seit alter Zeit genutzt, die herb schmeckenden Früchte wurden zu Marmelade und Kompott verarbeitet. Den antiken Schriftstellern war die Pflanze nicht bekannt, da sie im Mittelmeergebiet nicht vorkam.
Eine allgemeine Verwendung fand die Bärentraube erst im 18. Jahrhundert. Frische Blätter wurden zur Behandlung von Wunden (offene Beine) genutzt.
Wegen des hohen Gehalts an Gerbstoffen wurden Bärentraubenblätter früher auch zum Gerben von Leder benötigt. „Saffianleder“, ein feines Ziegenleder für Handschuhe und Bucheinbände wurde auf diese Weise hergestellt.

05132 505 1150 | Rathausplatz 1 | 31275 Lehrte
Stadtmarketing Lehrte e.V.